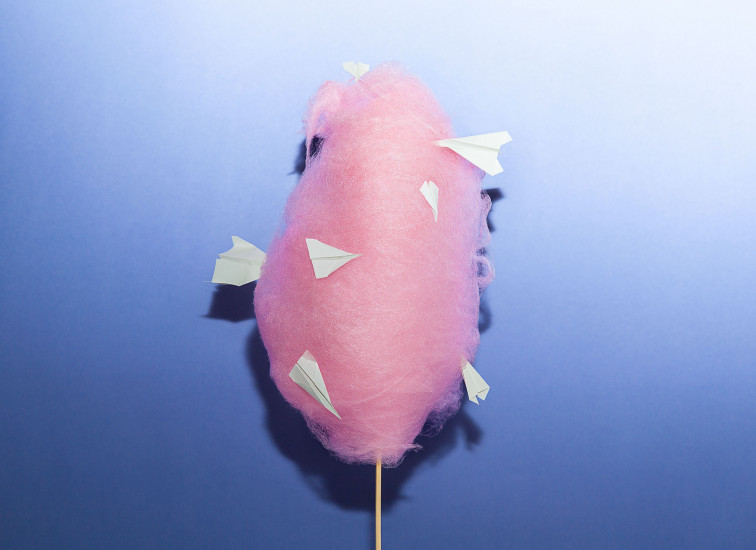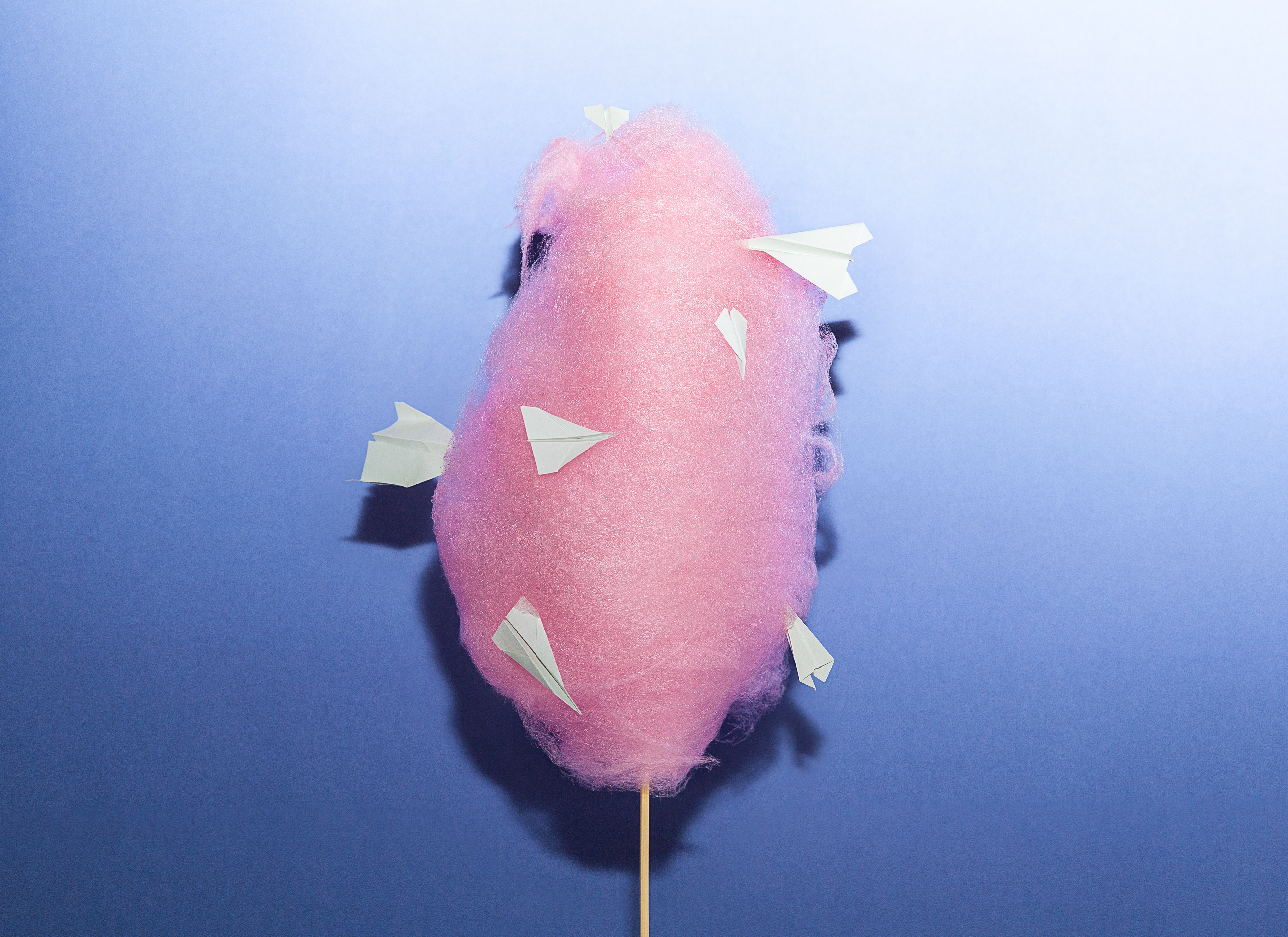Mein Name ist Maline Mandarine, und ich lebe mit einer Bipolaren Störung Typ 1. Diese Diagnose erhielt ich im Alter von 20 Jahren. Leider sind psychische Krankheiten in grossen Teilen unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Über meine Krankheit zu schreiben, ist deshalb eine Kampfansage. Um mich nicht unnötig einer möglichen Stigmatisierung auszusetzen, schreibe ich unter einem Pseudonym.
Was mit mir los ist, erfuhr ich, nachdem ich eine schwere Depression überlebt hatte und mit einer Manie in der psychiatrischen Akut-Station gelandet war. Diese komplett gegensätzlichen Episoden machen eine Bipolare Störung aus.
Über die depressive Symptomatik wissen heute viele Leute Bescheid: Energieverlust, bedrückte Stimmung, Schlafstörungen, Verlust von Freude und Interessen bis hin zu Suizidalität. Menschen mit einer bipolaren Störung haben ein enorm erhöhtes Risiko der Selbsttötung. Manisches Verhalten dagegen wird in der Gesellschaft zwar oft als irritierend wahrgenommen, aber meist nicht als Teil einer psychischen Krankheit erkannt. Rasende Gedanken und Ideen, erhöhte Kreativität, die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit bis hin zu Halluzinationen waren bei mir in manischen Phasen an der Tagesordnung. Diese komplett unterschiedlichen Krankheitsbilder können direkt ineinander übergehen, gemischt auftreten, oder es kann eine längere Zeit ohne Symptome vergehen. Der Krankheitsverlauf ist sehr individuell. Falls du mich heute auf der Strasse treffen würdest, wäre mir nichts anzumerken. Ich befinde mich aktuell in einer symptomfreien Zeit. Nach drei Jahren mit Medikamenten zur Stimmungsstabilisierung durchlebe ich nun die ersten Monate ohne die Helfer in Tablettenform. Diese Kolumne möchte ich in den nächsten Monaten nutzen, um Einblicke zu geben, wie ich mit dieser psychischen Erkrankung lebe. Ein Ritt auf einer Achterbahn.
Ps:Es geht mir heute wirklich gut. Falls es dir nicht gut geht – und das definierst du alleine – such Hilfe! Du bist nicht alleine.
Vom Regen in die Traufe
Stundenlang stand ich in meinem Zimmer, Downtown San Francisco, ohne wirklich anwesend zu sein. Ein komisches Gefühl; ich konnte nicht handeln und fühlte mich im eigenen Körper fremd. Dissoziation nennen das die Ärzte später in der Psychiatrie. Als ich die Abende nach der Sprachschule fast ausschliesslich zombiemässig verbrachte, rief ich meine Tante in der Schweiz an. Seit meiner Kindheit ist sie eine enge Bezugsperson, und sie hat als Pflegefachfrau mit psychisch kranken Menschen gearbeitet. Ahnungslos, was mit mir los war, dachte ich mir: Falls mich jemand verstehen kann, dann sie.
Nach einem nervenaufreibenden Telefonat einigten wir uns darauf, dass ich meinen Sprachaufenthalt frühzeitig abbrechen und in die Schweiz zurückkehren würde. Eine Entscheidung, die ich mir später immer wieder als Versagen vorgeworfen habe. Verliererin.
Rückblickend ist mir unklar, wie ich es überhaupt alleine zum Flughafen und ins Flugzeug geschafft hatte. In Amerika ist ausreisen schlicht sehr viel einfacher als einreisen. Zurück zu Hause verschlechterte sich mein Zustand zusehends, und meine Mutter schlug vor, dass ich mich in Therapie begeben solle. Es war Winter und mein Studium würde erst im September beginnen. Ohne Perspektive für die nächsten neun Monate liess ich mich in eine Klinik bringen. Auf der kantonalen Therapiestation für junge Erwachsene besserte sich mein Gemütszustand überhaupt nicht. Die Gruppendynamik unter den Patienten erinnerte mich an den Schulhof – und ich war die Neue. Ganz sicher keines der «Cool-Kids».
Ich ass nicht mehr richtig. Nachts lag ich wach, den Kopf voller Existenzangst und Angst davor, überhaupt zu existieren. Das Loch, in welches ich gefallen war, entwickelte sich zu einem bodenlosen. Die Tage zogen an mir vorbei, und ich wollte einfach nur weg.
Depression lautete die Diagnose. Die Medikamente bräuchten Zeit, bis sie ansprechen würden. Zeit, die ich mir nicht geben wollte. Ich verlor mich selbst. Verlor jegliche Zuversicht. Verlor den Willen, weiterzuleben. In diesem Zustand war ich auf einer Therapiestation untragbar. Die Ärzte verschoben mich in eine geschlossene Akutstation. Dort gab es keine Therapien, nur Schadensbegrenzung;
Gedämpft aber existent
Temesta, ein Benzodiazepin, wirkt angstlösend, sedierend, schlaffördernd und muskelentspannend. Bei mir hauptsächlich sedierend. Mein Kopf fühlte sich an wie Matsch. An meinen Aufenthalt in der geschlossenen Akut-Station der kantonalen psychiatrischen Einrichtung habe ich deswegen nur vage Erinnerungen. Wie in einem klischeehaften Film, der in einer Psychiatrie spielt, starrte ich die meiste Zeit im Flur an eine Wand.
Ich weiss nicht, ob es einen sinnvolleren Weg gibt mit suizidalen Menschen umzugehen, aber ich wurde durch Medikamente handlungsunfähig gemacht. Heute bin ich noch am Leben.
Einen Monat meines Lebens verbrachte ich zugedröhnt in dieser Anstalt. Nach einigen Wochen begannen die Ärzte das Benzo langsam auszuschleichen. Glücklicherweise bin ich nicht anfällig für Suchtentwicklungen – mir konnte das Absetzen gar nicht schnell genug gehen. Mit jeder Tablette, die wegfiel, fühlte ich mich wieder mehr wie ein Mensch und weniger wie ein Brei auf zwei Beinen. Nun war für mich klar, dass ich eine Therapie machen musste, und das wollte ich auch. Das ganze Chaos in mir aufräumen. Frühjahrsputz.
Eine Rückkehr auf die Station der jungen Erwachsenen in dieser Anstalt kam für mich nicht in Frage. Dort hatte sich meine Depression so sehr verschlimmert, dass ich nicht mehr leben wollte. Keinen Fuss wollte ich mehr da reinsetzen, die schmerzhaften Erinnerungen waren noch sehr präsent.
Eine andere Station für junge Erwachsene gab es in meinem Kanton nur noch in einer Privatklinik, und glücklicherweise erhielt meine Mutter für mich eine Kostengutsprache der Krankenkasse.
Mein Wille, den ich verloren geglaubt hatte, meldete sich zurück. So wollte ich zwar nicht weiterleben, sterben war aber keine Option mehr.
Ich telefonierte mit dem Chefarzt der Privatklinik und gab ihm mein Wort, dass ich die Therapie bei ihm durchziehen werde. Zwei Wochen musste ich zu Hause überstehen; die obligatorische Pause zwischen einem Aufenthalt auf einer Akut-Station und einer Therapie-Station. In diesen zwei Wochen habe ich vor allem geschlafen und die Wohnung nicht verlassen. Danach durfte ich in die Privatklinik einziehen. Sechs Wochen würde die Therapie dauern;
Therapiestations-Crew
Wir sitzen in einem Untergeschoss. Wir, das sind in diesem Moment sieben Menschen zwischen 18 und 25 Jahren jung, und hier, weil alle von uns momentan nicht mit ihrem Leben klarkommen. In der Mitte steht eine lebensgrosse Stoffpuppe. Diese ähnelt ein bisschen einem Dummy. Hier dient sie aber nicht der Autounfall-Simulationen, sondern sollte für uns hinhalten. Mit mehr oder weniger unbekannten Menschen Emotionen an einer Puppe rauszulassen, fühlt sich anfangs mindestens so schräg an, wie es klingt. Aber da es sowieso nicht viel anderes zu tun gibt, entscheide ich mich, das mulmige Gefühl in mir zu überwinden. „Dänn halt,“ denke ich mir. Immerhin gilt es, den Halt wiederzuerlangen – da schien mir meine Würde im Tausch kein schlechter Deal. Ich lasse mich darauf ein. Die Therapie nennt sich Schema-Gruppentherapie. Hier landen all diejenigen, die nicht mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden. Manchmal wünsche ich, ich wäre auch bei den «Bordis»; deren «Dialektisch-Behaviorale-Therapie» wirkt super strukturiert. Wenn wir in der freien Zeit keine Kartenspiele spielen, lasse ich mir von ihnen viele ihrer erlernten «Skills» erklären. Dazu gehört beispielsweise die Achtsamkeit, sich in einem Moment auf das zu konzentrieren, was da ist, ohne es zu bewerten. Das Gefühl dazuzugehören, hatte ich lange nicht. Doch hier, auf dieser Station scheint es so, als wäre ich gar nicht so falsch, gar nicht so allein, gar nicht so komisch. Mit Widerwillen akzeptiere ich, in einer Gruppe wohlauf zu sein. Ob diese Menschen in Zukunft eine grosse Rolle in meinem Leben spielen werden, wage ich zu bezweifeln. Jedoch sind sie in diesen Wochen meine wichtigsten Bezugspersonen.
Wir haben zusammen gegessen, gelacht, geweint, geschrien, Ping-Pong gespielt und uns über unsere Medikation ausgetauscht;
Diagnosen-Dilemma
Fünf verschiedene Antidepressiva werden an mir während meinen Aufenthalten in Kliniken ausprobiert. Versuchskaninchen. Die einen klappen meinen Kreislauf zusammen, andere lassen meinen Appetit komplett erlöschen, wieder andere sorgen für üble Bauchschmerzen, Schwindel oder Kopfschmerzen. Dies alles, ohne die gewünschte Wirkung zu erzielen. Kurz vor meinem Austritt scheint endlich ein Mittel gefunden, welches meine Stimmung erhellt. Ich fühle mich lebendig. Nebenwirkungen sind keine extrem störenden festzustellen, und die Ärzte sind zuversichtlich, dass ich zum geplanten Termin die Klinik verlassen kann. Ein Erfolg für die Medizin!
Rückblickend wusste ich da schon, dass sich irgendetwas nicht stimmig anfühlte. Ich war zwar guter Stimmung, aber irgendwie innerlich gehetzt. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich vor meinen dunkelsten Monaten bereits so aufgedreht war. Zweifel kriechen in mir hoch. Doch statt meinen Bedenken Raum zu geben, rede ich mir ein, dass ich mich einfach nicht mehr erinnern kann, wie es ist, nicht depressiv zu sein. Zu gross die Sehnsucht nach einem Leben ausserhalb von Klinikgeländen.
Zuhause bin ich wie ausgewechselt. Zuerst freuen sich meine Verwandten und Freundinnen, wieder ihre alte Maline zurückzuhaben. Doch von Tag zu Tag wird mein Verhalten verstörender. Ich bin leicht reizbar, egoistisch, suche ausschliesslich das Vergnügen, handle, ohne Risiken zu bedenken. Als ich eines Abends meinen halben Zimmerboden mit Acrylfarbe bemale und darüber irgendwie keine Kontrolle habe, bitte ich meine Mutter, mich wieder in die Klinik zu fahren.
In diesem Zustand wird den Ärzten schnell klar: Depression ist nur die Hälfte meiner Diagnose. Eine Bipolare Störung wird diagnostiziert. Dass bis zur treffenden Diagnose nur ein halbes Jahr Behandlung verging, ist eher ein Glücksfall. Oftmals dauert dieser Prozess nämlich Jahre;
Im Film
Geschmeidig wie eine Katze rolle ich mich seitlich vom Bett herunter auf den Boden. Die Laserstrahlen dürfen mich nicht treffen. Schliesslich bin ich Lara Croft. Actionheldin in meinem eigenen, manischen Film. Offensichtlich war das Lithium nicht richtig dosiert. Schlafen ist unmöglich, da sind zu viele Gedanken und zu viel Energie. Die Akutstation sieht so langweilig aus, dass ich malen muss. Zum guten Glück habe ich einen guten Draht zur Nachtwache und darf auch in der Nacht Acrylfarben aus der Werkstatt holen. Zwischendurch hilft Kreativität ganz gut, um die Gedanken zu kanalisieren.
Am nächsten Tag ist es öde, ich darf nicht nach draussen und werfe Blumen aus dem Fenster, die zur Dekoration in einer Vase des Raucherzimmers stehen. Also, aus dem kleinen Spalt zwischen offenem Fenster und davor angebrachtem Plexiglas. Jemand vom Pflegepersonal findet das nicht lustig, sie versuchen mich davon abzubringen. Mir ist das ziemlich egal und es beginnt ein Streit, der für mich mit einer Nadel im Oberarm, von fünf Personen umzingelt in der Ecke eines Zimmers endet. Mir ist schwindelig, ich schwitze, mein Mund ist trocken. Das war ein neues Medikament.
Und dann befinde ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Isolationszimmer. Es gibt etwas Matratzenartiges und einen Klotz, der wohl ein Sessel sein soll. Alles ist aus blauem Schaumstoff. Panik kriecht in mir hoch und ich beginne zu schreien. «Lasst mich raus!» Die nächsten Stunden verbringe ich damit, den Schaumstoffsessel gegen die Wand zu werfen, bis ich nicht mehr kann. Irgendwann bin ich vom Ausrasten, Schreien und Weinen so erschöpft, dass ich mich beruhige. Ins Bad, also auch auf die Toilette, darf ich nur unter Aufsicht des Personals. Ich fühle mich entwürdigt. Ich suche das Gespräch und darf das Isolationszimmer schliesslich verlassen. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte, wie lange ich da drin war, bin aber unglaublich froh, wieder in einem normalen Zimmer zu sein und möchte da nie wieder hin müssen;
Runterkommen
Nach meinem unfreiwilligen Aufenthalt im Isolationszimmer scheinen die Ärzte mit der Einstellung meiner Medikation wirklich vorwärts zu machen. Abends bekomme ich stets ein Antipsychotika, mit dem ich ein wenig schlafen kann, die Lithium-Dosis wird zudem erhöht. Langsam aber sicher klingt die Manie ab. Endlich kann ich wieder ein paar Seiten lesen, ohne komplett die Konzentration zu verlieren. Meine Gedanken lassen sich sortieren, und ich rede wieder mit Punkt und Komma. Plötzlich ist da Platz in meinem Denken für die Gefühle anderer Menschen und mein Mitgefühl. Eine Manie ist etwas unglaublich Überforderndes und Anstrengendes; für das Umfeld vermutlich noch mehr als für mich als Betroffene. Freundinnen, die mich seit der Schulzeit kennen, hat mein Verhalten während der letzten Wochen unfassbar irritiert. Für sie ist es unmöglich, so etwas nachzuvollziehen. In der Klinik jedoch kann ich mich mit Menschen austauschen, die ähnliche Erlebnisse hatten.
So baue ich eine Freundschaft zu Elisa auf. Wir gehen täglich spazieren. Sie hat so ziemlich jede denkbare Diagnose und befindet sich gerade in einem ziemlichen Tief. Auf der Station dissoziiert sie regelmässig. Aus diesem Zustand der geistigen Abwesenheit kann ich ihr meistens irgendwie raushelfen; ich lese ihr Bücher vor, deren Inhalt wir nicht verstehen; fülle Notizbücher mit Worten, die ich noch nachschlagen möchte. Die Bibliothek auf dem Gelände ist unser sicherer Hafen.
Die Freundschaft zu Elisa bedeutet mir in diesen Wochen unglaublich viel. Das gegenseitige Vorlesen hat etwas Beruhigendes, es ist etwas «ganz Normales» in einem Alltag voller abnormaler Erfahrungen;
In Schutzfolie gepackt
Mein Leben fühlt sich an, als hätte ich einen Taucherhelm aufgesetzt. Ich sehe eine Umwelt und kann auch an ihr teilhaben, aber so richtig dabei bin ich nicht.
Die Tage gleichen sich auf unbehagliche Weise, mein Gefühlsleben ist abgestumpft. Mittlerweile verstehe ich die geschluchzten Zeilen von Evanescence-Sängerin Amy Lee: «Don’t wanna forget how it feels without lithium». Denn es fühlt sich wirklich anders an mit dem Wirkstoff. Gleicher, okay, einheitlich. Wahrhaftige Freude oder Traurigkeit kommen nicht vor. Es geht mir okay, immer.
Mit der Diagnose Bipolare Störung wurden mir nicht wirklich viele Medikationsmöglichkeiten aufgezeigt, Lithium ist langfristig betrachtet das effektivste Mittel. Es sorgt dafür, dass die Stimmung weder zu tief noch zu hoch schwankt. Wie genau das funktioniert, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Aber es funktioniert. Neben der gewünschten Wirkung gibt es aber auch noch ein paar Effekte obendrauf: zitterige Hände, Verdauungsprobleme, Konzentrationsstörungen und gar eine Schilddrüsenunterfunktion sind es bei mir. Aber trotz allem bin ich froh um die Stabilität, die mir das Lithium bietet. Dafür, dass ich endlich wieder einen geregelten Alltag leben kann, bin ich bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen;
Von allem zu viel, zu viel von allem
Meine Liebhaberin hält mich in ihren Armen, während ich Musik höre. Wir hatten ungefähr drei Mal Sex. Meinetwegen hätten wir noch viele Male mehr haben können.
Gestern noch bin ich irgendwo im Aargau im Bett eines Typen gelegen. Ihn kenne ich schon seit Jahren. Aber mögen tue ich ihn – im Gegensatz zur Frau, bei der ich gerade liege – nicht wirklich. Der einzige Grund, wieso ich bei ihm gelandet war, war die Einfachheit dieses Vorhabens.
Letzte Woche schlug ich einer Bekannten und ihrem Freund, über deren Beziehungsform ich rein gar nichts wusste, eine Ménage à trois vor. Einfach so, während wir in einer Bar Bier tranken.
Die Ereignisse überschlagen sich in Retrospektive. Noch immer spielt eines meiner Lieblingslieder – ist es auf Dauerschlaufe? Seraina ist eingeschlafen und ich winde mich aus ihrer Umarmung. Etwas holprig von der ganzen Anstrengung tapse ich zu ihrem Laptop, um mich zu vergewissern, dass die Musik aus dessen Lautsprecher schallt. Tut sie nicht. Die Musik ist nur in meinem Kopf.
Die Lithium-Dosierung war wohl doch nicht nachhaltig und ich beginne allmählich zu begreifen, dass die ganze Genusssucht der letzten Wochen Symptome einer Hypomanie sind. Und mir dämmert: Ich werde zum vierten Mal in diesem Jahr in die Klinik müssen. In meinem nahen Umfeld bin ich die letzten Wochen auf Unverständnis meinem Verhalten gegenüber gestossen. Deswegen habe ich mich mit weniger bekannten Menschen herumgetrieben. Wer mich zu dieser Zeit kennengelernt hat, war fasziniert oder überrumpelt von meiner Energie, meiner Kreativität, meiner Offenheit. Aber ich bin nicht wohlauf. Ausschweifendes Shopping, massenhaft sexuelle Bekanntschaften, gestörtes Essverhalten, riskantes Auto fahren, Alkohol – es ist alles zu viel. Ich bin momentan zu viel;
Auf Wiederlesen;
Das wars mit der Reise durch meine Krankheitsgeschichte, liebe Leser*innen. Die Kolumnen widerspiegelten chronologisch meinen Krankheitsverlauf mit der Diagnose Bipolare Störung. Nun ist es an der Zeit, mit dem Rückblick in die eigene Geschichte abzuschliessen. Diese Zeilen zu schreiben, war nicht immer einfach, oft aufreibend und noch häufiger lehrreich. Heute, ein Jahr und vier Monate nachdem ich das Lithium absetzen konnte, geht es mir okay, oftmals sogar gut. Ich bin stabil.
Was bleibt, ist die Hoffnung, dass es so weitergeht. Und die Angst, dass die Stabilität vergehen könnte. Ich blicke mit scheuer Zuversicht in meine Zukunft. Die Krankheit und deren Therapie waren eine exzellente Schule über mich selbst. Oftmals ist meine Krankheit ganz weit weg und mein Alltag völlig gewöhnlich.
Was aber auch bleibt, ist eine «Alarmiertheit». Eine «Alarmiertheit», dass drei schlechte Tage am Stück nicht bloss drei schlechte Tage sind. Der Zweifel, der an mir nagt und mich fragen lässt, ob das wohl der Beginn einer depressiven Phase sei. Was, wenn die Grauzonen erneut zu schwarzen Löchern mutieren?
Bin ich zu energetisch und aufgekratzt, mache ich mir Sorgen, dass das die Vorboten einer (Hypo-)Manie sind. In mir läuft dann schon der ganze mögliche Verlauf ab.
Welche Notfall-Medikation wird anschlagen? Wie werde ich sie vertragen? Muss ich wieder in die Klinik? Zahlt meine Krankenkasse dafür, dass ich wieder in die gleiche Klinik kann wie vor Jahren oder muss ich in eine neue, kantonale Klinik? Wie wird mein Umfeld reagieren, wie meine Arbeitgeberin? Muss ich danach wieder anfangen Lithium zu nehmen? Für immer?
Glücklicherweise kenne ich diese Gedankengänge und kann sie meist stoppen.
Für den Notfall – falls die Ängste und Zweifel über Tage zu laut an mir nagen – habe ich Medikamente, die meinem Hirn eine Entschleunigung ermöglichen.
Mir hilft regelmässiger Schlaf, genügend Bewegung, frische Luft, schreiben, selten eine Tablette Valium und ein wundervolles Umfeld. Danke an all diejenigen, die mich begleiten. J, L, B, ihr seid meine Anker.
Ich hoffe, ich konnte euch, liebe Leser*innen einen unverblümten Einblick ins Leben mit einer psychischen Krankheit gewähren.
Der beste Part der Geschichte ist vielleicht noch nicht geschrieben;
Ein Semikolon, denn: Deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Mehr Informationen zum Projekt Semicolon unter: projectsemicolon.com